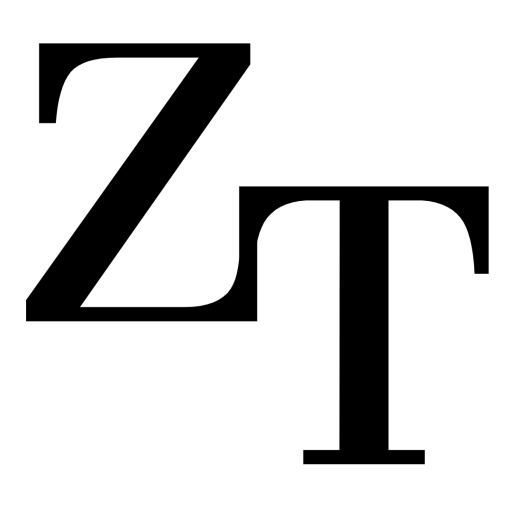Die Quantentechnologie markiert einen wissenschaftlichen Meilenstein, dessen Tragweite enorm ist. Dennoch bedeutet ein wissenschaftlicher Durchbruch nicht automatisch, dass er sofort in der Industrie oder im Alltag ankommt. Oft braucht es Zeit, bis sich neue Anwendungen entwickeln und die Technologie wirklich alltagstauglich wird.
Seitdem Werner Heisenberg 1925 die mathematische Grundlage der Quantenmechanik gelegt hat, sind nun fast 100 Jahre vergangen. Heutzutage stehen wir vor der Herausforderung, die richtige Technologie zu wählen, denn es gibt mittlerweile verschiedene Ansätze, um Quantencomputer weiterzuentwickeln und tatsächlich zu bauen.
Momentan gehören supraleitende Qubits zu den weltweit führenden Technologien im Bereich des Quantencomputings. Dieser Ansatz wird unter anderem von Technologiekonzernen wie IBM und Google verfolgt. Die supraleitenden Qubits basieren nicht direkt auf klassischer Halbleitertechnologie, sondern auf supraleitenden Schaltkreisen, die mit speziellen Josephson-Kontakten arbeiten. Die Herstellung dieser Schaltkreise erfordert hochpräzise Fertigungstechnologien – vergleichbar mit der Halbleiterindustrie –, allerdings in spezialisierten Reinraumumgebungen und oft mit noch strengeren Anforderungen.
Ein wesentlicher Nachteil ist der enorme technische Aufwand: Damit diese Qubits überhaupt funktionieren, müssen sie auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt (−273,15 °C) heruntergekühlt werden – typischerweise unter 20 Millikelvin. Das geschieht mithilfe komplexer und teurer Kryostaten. Entsprechend sind Milliardeninvestitionen nötig, um diese Technologie im industriellen Maßstab weiterzuentwickeln.
Gibt es denn andere, wirtschaftlichere Wege?
Ja, die gibt es. Vereinfacht gesagt liegt der Kernunterschied aller Quantencomputer-Technologien bei dem physikalischen Träger
Dieser bestimmt:
- Wie die Information gespeichert wird
- Wie empfindlich das System ist
- Wie gut man es kontrollieren kann
- Wie leicht es skalierbar ist
- Und auch, wie viel Technik und Kühlung man drumherum braucht
Bei meinem Messebesuch der Automatica 2025 in München dürfte ich über eine von diesen Technologien mit Alexander Glätzle CEO & Co-Founder planQC unterhalten.
Der Ansatz von PlanQC basiert auf Neutralatom-Qubits, bei denen einzelne Strontium-Atome als physikalische Träger verwendet werden. Die Quanteninformation wird in stabilen inneren Zuständen der Elektronen gespeichert – etwa im Spin oder in präzise definierten Energieniveaus. – erklärt A.G.
PlanQC setzt auf Neutralatom-Qubits – eine ursprünglich anmutende, aber hochmoderne Technologie. Statt künstlich hergestellter Qubits nutzt man natürliche, identische Atome wie Strontium, in denen Informationen etwa im Spin von Elektronen gespeichert werden. Diese Systeme arbeiten nahe Raumtemperatur, benötigen keine aufwändige Kühlung und bieten lange Kohärenzzeiten – zentrale Vorteile für die Skalierung. Die Technologie basiert auf jahrzehntelanger Forschung am Max-Planck-Institut und der LMU München. Angesichts der jüngsten strategischen Kehrtwenden großer Tech-Konzerne wie Google und Microsoft hin zu Neutralatomen sieht sich PlanQC in seinem Ansatz bestätigt.
„Unser Ansatz der Neutralatome ist vielleicht die ursprünglichste Art, Quantencomputer zu bauen. Hätte man vor hundert Jahren einen Heisenberg oder Einstein gefragt, was ein Qubit ist, hätten sie vom Spin eines Elektrons gesprochen. Genauso speichern wir Informationen im Spin des Elektrons, das in Atomkernen kreist“
Als Laie fragt man sich natürlich, wie ein Quantencomputer von PlanQC in naher Zukunft aussehen wird.
„Das Endprodukt soll ein rackbasierter Quantencomputer sein – vergleichbar mit den Server-Schränken aus heutigen Rechenzentren. Rund fünf dieser Racks werden benötigt, um alle Komponenten unterzubringen: von präzisen Lasersystemen über Steuerelektronik bis hin zur Quantum Processing Unit. In deren Vakuumkammer werden die Strontiumatome eingefangen und kontrolliert – dort geschieht die eigentliche Quantenberechnung“.
Wäre es naiv, sich vorzustellen, dass Quantencomputer eines Tages wie ein PC im Handel erhältlich sein werden?
„Ich würde sagen: Sag niemals nie. Da haben sich schon andere die Finger verbrannt – denken wir nur an die IBM-Aussage aus den 1960ern, dass es keinen Markt für Personal Computer gäbe. Aber realistisch betrachtet: In den nächsten zehn bis zwanzig Jahren wird es keine Quantenprozessoren in Laptops oder Handys geben – und wir werden sie auch nicht brauchen. Quantencomputer kommen dort zum Einsatz, wo Supercomputer an ihre Grenzen stoßen: bei Materialsimulationen, chemischen Reaktionen, in der Pharmaforschung oder bei Klima- und Wettermodellen. Diese Maschinen gehören in große Rechenzentren – genau dort werden sie als erstes ihren Platz finden.“
Wann können wir denn mit dem praxisnützlichen Produkt Ihres Unternehmens rechnen?
Unser Plan sieht vor, ab 2027 aus dem Labor raus und rein in die Datenzentren unserer Kunden zu kommen.
Quantensichere Kommunikation: Vorsprung vor der Bedrohung
Zu diesem Aspekt der Sicherheit habe ich mit einem Spezialisten auf diesem Gebiet gesprochen. Jan Schreck, Doktorand am Max-Planck-Institut in Erlangen.
Im Rahmen des Projekts Qnet arbeitet Jan an einer Technologie, die Kommunikation selbst gegen zukünftige Quantencomputer absichern soll. Das Ziel: Quantenverschlüsselung, die sich auf fundamentale Prinzipien der Quantenmechanik stützt – allen voran das sogenannte No-Cloning-Theorem, das besagt, dass ein Quantenzustand nicht exakt kopiert werden kann.
Diese Technologie, bekannt als Quantum Key Distribution (QKD), nutzt zufällige Quantenzustände – etwa Polarisationen von Lichtteilchen – um zwischen Sender und Empfänger einen gemeinsamen, abhörsicheren Schlüssel zu erzeugen. Jeder Versuch eines Abhörens würde den Zustand irreversibel verändern und so als Störung erkennbar sein. „Der eigentliche Empfänger würde merken, dass jemand lauscht – einfach, weil plötzlich mehr Fehler auftreten als physikalisch zu erwarten wäre„, erklärt der Forscher.
Obwohl universell einsetzbare Quantencomputer noch nicht Realität sind, ist die Bedrohung durch sie bereits greifbar: Kommunikation, die heute aufgezeichnet wird, könnte in Zukunft entschlüsselt werden. Einige Unternehmen investieren deshalb bereits jetzt in quantensichere Systeme – nicht zuletzt, weil es bereits erste QKD-Geräte kommerziell zu kaufen gibt. Parallel dazu wird auch an klassischer Kryptographie gearbeitet, die gegen Quantenangriffe resistent sein soll – ein Rennen auf mehreren Ebenen.
Ausblick: Auch wenn noch viele technologische und praktische Hürden zu überwinden sind – die Entwicklungen rund um Quantencomputer und quantensichere Kommunikation zeigen, dass wir bereits heute beginnen müssen, die Welt von morgen mitzugestalten. Wer jetzt investiert, forscht und vorbereitet, legt den Grundstein für eine digitale Zukunft, die nicht nur leistungsfähiger, sondern auch sicherer ist.